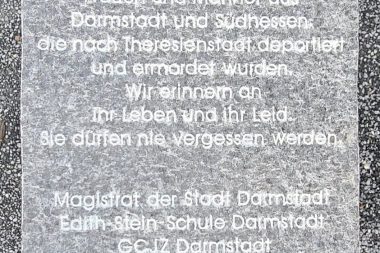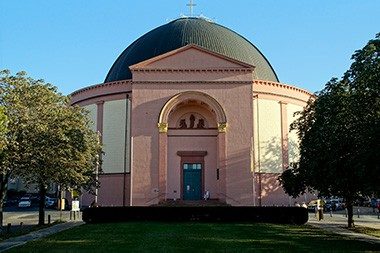Rund um den 9. November hatte die Stadt Darmstadt in Kooperation mit einer Reihe von Initiativen und Einrichtungen, unter anderem auch der GCJZ Darmstadt, ehemalige jüdische Bürgerinnen und Bürger Darmstadts und ihre Nachkommen eingeladen zu einem Programm des Austausches und der Begegnung. Hier berichten einige unserer Mitglieder kurz über diese Tage.
Joachim Keidl: Beim Mittagessen und Abendessen des ersten Besuchstages saß ich mit meiner Frau zusammen mit dem Ehepaar Ranis aus New York zusammen, die mit zwei Enkeln und einem Neffen der Einladung der Stadt Darmstadt gefolgt waren. Peter Ranis konnte als sechsjähriger Junge gemeinsam mit seine Eltern dank der Vermittlung des jüdischen Rechtsanwalt Benno Joseph 1941 mit einem Visum nach Argentinien entkommen. Seine Familie wohnte damals in der Riedeselstraße. Sehr erfreut war Peter Ranis, dass ich ihm noch zu einem Exemplar der Neuausgabe von „Juden als Darmstädter Bürger“ verhelfen konnte. Wie er mir nach seiner Rückkehr aus New York schrieb, hat das Buch bei ihm viele Erinnerungen an frühere Reisen und Begegnungen mit Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde in Darmstadt wieder in Erinnerung gerufen.
Marion Keidl: Ein besonderes Erlebnis war es für mich, gemeinsam am Freitagabend den Schabbat zu beginnen, liebevoll vorbereitete Speisen zu genießen und im Gespräch mit den Geschwistern Rosenthal aus Berlin mit einem Schabbatwein auf das Leben anzustoßen: L`Chaim.
Ulrike Schmidt-Hesse: Vielfalt und Demokratie leben
Während der vier Tage des Besuchs der jüdischen Darmstädterinnen und Darmstädtern hatte ich viele kurze Unterhaltungen und einige sehr ausführliche Gespräche. Einige davon mit Personen aus den USA, Israel, Dänemark, England und Deutschland sind mir noch besonders gegenwärtig. Dazu gehören neben Gesprächen über die Terroranschläge der Hamas und ihre Folgen auch die Zeit- bzw. Zweitzeugengespräche in den Schulen.
Dabei begegneten die Schülerinnen und Schüler Menschen, die orthodox, liberal oder gar nicht religiös sind, die ganz unterschiedliche Familiengeschichten und aktuelle Lebenssituationen haben, die unterschiedliche Positionen zur Politik der Regierungen ihrer Länder einschließlich Israels vertreten, die oft in multikulturellen Familien leben. Von dieser Vielfalt jüdischen Lebens zu erfahren, das war nach meinem Eindruck – zusammen mit den Geschichten von Verfolgung und Flucht und der Wirkung dieser Erfahrungen auf die Kinder und Enkel – für die Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Herkunft sehr wichtig.

Mich selbst beschäftigt im Nachhinein auch folgende Frage: Müssten nicht im Interesse des „Nie wieder!“ auch die Kinder und Enkel nicht-jüdischer Deutscher Schüler:innen ihre Familiengeschichten erzählen? Geschichten von Unterstützern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, von Mitläuferinnen, Zuschauern, Nutznießerinnen, Zweifelnden, Menschen in der inneren Emigration, Helferinnen für Verfolgte, oft nur im Kleinen – von Menschen, die manchmal Verschiedenes zusammen waren? Nachkommen von Widerstandskämpfer:innen sind ja die allerwenigsten von uns. Ich denke, es wäre gut, als Nachkommen der Täter:innen mehr davon zu erzählen, wie uns diese Familiengeschichten geprägt haben und welche Konsequenzen wir daraus ziehen.
Karmit Binka-Shalev aus dem Kibbuz Shaar-Haamakim trug am Begrüßungsabend einen Text ihres Vaters vor, den dieser verfasst hatte, weil er nicht mehr reisen konnte. Die Familie Storper hatte ein Geschäft für Südfrüchte in der Ludwigsstraße, Uri ging als einziges jüdisches Kind in Bessungen zur Schule, bis er diese Schule 1934 verlassen musste. Er berichtete vom Boykott des Geschäfts seiner Eltern, von der Flucht der Familie 1938 nach Rumänien und der Auswanderung nach Palästina 1943, wo er seither in diesem Kibbuz im Norden Israels lebte. Er hatte Darmstadt früher aufgrund einer Einladung des Oberbürgermeisters besucht und schrieb dazu: „Die Kontakte gründen auf dem gemeinsamen Verständnis von zwei demokratischen freiheitlichen Staaten, die trotz einer furchtbaren Vergangenheit versuchen zusammenzuarbeiten.“ Dass dies auch in Zukunft so sein möge, war sein Wunsch. Dieses Zeugnis eines 96 Jährigen und die Gespräche mit seiner ehrenamtlich auch in einem Krankenhaus mit meist beduinischen Patient:innen engagierten Tochter haben mich sehr beeindruckt.
Ulrike Volke: Ein Grab, das Generationen verbindet
Shmulik Sich-El und ich kennen uns seit fünf Jahren. 2018 war er als Holocaust-Betroffener auf nach Darmstadt gekommen. Die Stadt hatte ihn eingeladen. Bei einem der gemeinsamen Essen kamen wir ins Gespräch. Ich staunte, wie gut er deutsch sprach, wie gut er Darmstadt kannte. Er erzählte mir, dass seine Eltern und seine Großeltern Heiner waren. Und dass er bis zum Tod seiner Eltern nur Deutsch mit ihnen gesprochen habe. Seine Mutter habe nie Hebräisch geprochen, weil sie ihre deutsche Sprache so liebte. Nach dem Tod seiner Eltern gab es nur noch eine Kusine in Israel, mit der er deutsch sprechen konnte. Aber die sei letztes Jahr gestorben. Wir tauschten unsere Telefonnummern aus. Von da an telefonierten wir oft miteinander. Er erzählte von seinem Sohn, von seiner Tochter den beiden Enkelkindern in Israel – und auch von seiner Großmutter, die im KZ ermordet worden war. Ich erfuhr, dass die andere Großmutter und beide Großväter auf dem jüdischen Friedhof in Darmstadt beerdigt sind.
Als Schüler und Schülerinnen von Shmuliks im KZ umgebrachten Großmutter hörten, meinten sie: „Omas sind so wichtig! Für Shmulik Sichels Oma setzen wir einen Stolperstein!“ Das taten sie 2019.
Zur Stolperstein-Verlegung reiste Shmulik mit seinem Sohn und seiner Tochter an. Letztes Jahr kam er mit seiner Lebensgefährtin ein paar Tage zu uns nach Kranichstein. Bei all seinen Besuchen war es ihm sehr wichtig, dass wir die Gräber seiner Vorfahren aufsuchten – und natürlich auch den Stolperstein, der an seine ermordete Großmutter erinnerte. Im November nun war er wieder Gast der Stadt Darmstadt. Inzwischen 84 und gesundheitlich angeschlagen brauchte er die Unterstützung seiner Tochter als Begleitperson. Die konnte aber ihre beiden Kinder nach dem Hamas-Angriff nicht alleine in Israel lassen. So ergab es sich, dass nun drei Generationen der Familie Sich-El zu diesem Treffen anreisten. Schon am ersten Tag fragte Shmulik: „Wann gehen wir zum Friedhof?“

Mit Tochter und Enkeln fuhren wir zu den Gräbern seiner Großeltern. Als wir vor dem Grab von Samuel Sichel standen, war er bewegt. „In Deutschland hießen wir Sichel. In Israel wurde daraus Sich-El. Von Samuel, meinem Großvater, habe ich den Namen.“ Zur Tochter: „Dein Urgroßvater!“ Zu den Enkeln: „Euer Ururgroßvater!“
Und dann standen wir vor dem Grab seiner Großeltern mütterlicherseits. Die Enkel lasen die Namen und die Jahreszahlen laut. Shmulik hatte seine Großeltern nicht mehr kennengelernt. Aber er kann noch viele Geschichten zu ihnen erzählen. Lustige und ernste. Durch sein Erzählen wurden sie lebendig.
Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn sein Name vergessen ist!
Bernd Lülsdorf: Am Abend der Verabschiedung saß ich gegenüber von Ayelet Sich-el mit ihren beiden Kindern Mika und Kay. Schwester und Bruder saßen eher etwas gelangweilt auf der Bank und schauten beide intensiv in ihre Mobiltelefone. Mit Ayelet kam ich dann sehr schnell in ein Gespräch über Erziehung, Kinder und Medien und wir waren uns sehr bald einig: dieses Thema verbindet uns, ist herausfordernd und hat aber manchmal auch etwas Entlastendes.
Aus dem Gespräch nehme ich die Sorgen und Nöte mit die Eltern rund um den Globus haben. Hier genauso wie in Israel oder an allen anderen Orten der Welt. Darüber hinaus kann ich gar nicht begreifen, wie viel mehr Mütter und Väter in Israel und im Nahen Osten oder auch in der Ukraine mit der täglichen Bedrohung leben. Dieser Gedanke beschäftigt mich bis heute.