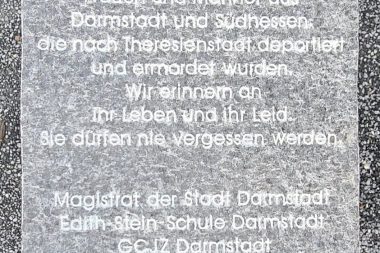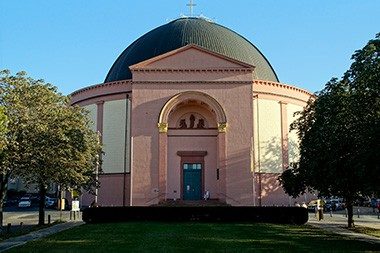Hier lesen Sie den Text der Rede, die von Dr. Manfred Göbel, Schulleiter der Edith-Stein-Schule Darmstadt zum Gedenken an die Zerstörung der Darmstädter Synagogen 1938 gehalten wurde.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Partsch,
sehr geehrter Herr Neumann,
meine Damen und Herren,
dass ich hier für die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit sprechen darf,
empfinde ich als eine Ehre auch für die Edith-Stein-Schule. Wir sind als Schule Mitglied der Gesellschaft, weil wir uns – allein schon im Hinblick auf die Namenspatronin unserer Schule – ihren Zielen verbunden und verpflichtet sehen.
Den Namen „Edith-Stein-Schule“ verdanken wir der Initiative der damaligen Schulleiterin, Frau Dr. Else Niebler, die der Schule mit diesem Namen zugleich ein Programm geben wollte. Sie hat dieses Schulprogramm in Orientierung an dem Lebensweg Edith Steins in fünf Punkten entfaltet und dieser Text steht uns nach wie vor an zentraler Stelle in der Schule vor Augen. Der 5. Punkt lautet:
„Das Opfer von Auschwitz verpflichtet, für die Achtung der Menschenrechte und Menschenwürde in aller Welt einzutreten. Es verpflichtet die Schule, die politische Bildungsarbeit in diesem Sinn ernst zu nehmen. Edith Steins persönliche Antwort auf Unrecht und Gewalt, ihre Bereitschaft zum Lebensopfer unter dem Sühnegedanken, ist Aufruf zu Versöhnung und Verständigung.“ In diesem Kontext unterstützen wir die Grundsätze der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, auch durch unsere Verbundenheit mit der Jüdischen Gemeinde Darmstadt, und auch durch unsere Schulpartnerschaften, insbesondere durch unsere Verbindung mit der Leo Baeck High School in Haifa, die wir im Januar zum dritten Mal wieder besucht haben (und deren Orchester auch bereits hier ein Konzert gegeben hat).
Im Kontext mit diesem Selbstverständnis unserer Schule steht auch, dass wir uns um die Anerkennung als UNESCO-Projektschule bemüht und diese vor einigen Jahren erhalten haben. UNESCO-Projektschulen bilden ein internationales Netzwerk; sie setzen sich gemäß ihren Leitlinien für eine Kultur des Friedens ein, für die Achtung der Menschenrechte, für Toleranz und Demokratie.
Mit diesen Leitlinien ist es meines Erachtens nicht vereinbar, dass die UNESCO, zuerst in einer Resolution des Exekutivrats am 12. Oktober und dann am 26. Oktober durch das WelterbeKomitee, den Tempelberg in Jerusalem aus offensichtlich politisch-taktischen Gründen ausschließlich als muslimische heilige Stätte definiert hat. Dies ist zu Recht auf zahlreiche Proteste jüdischer und christlicher Institutionen und Persönlichkeiten gestoßen. Beispielhaft zitiere ich us der Stellungnahme der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien: „Die Erinnerung an die dunkle Nacht der Shoah wäre wohlfeil, wenn sie nicht zu gesteigerter Wachsamkeit im Blick auf judenfeindliche Tendenzen der Gegenwart führen würde. So kann eine christliche Theologie, welche Auschwitz als Zeitindex ernst nimmt, nicht gleichgültig bleiben, wenn Juden in ihrem Selbstverständnis irritiert oder verletzt werden. Die jüngste NESCOResolution über den Tempelberg in Jerusalem muss daher als hochproblematisch, ja inakzeptabel zurückgewiesen werden …“
Als Leiter einer UNESCO-Projektschule mache ich mir diese Kritik uneingeschränkt zu Eigen und begrüße, dass sich die Generaldirektorin der UNESCO, Frau Irina Bokova, mittlerweile von der Resolution distanziert hat. Dennoch sind Resolutionen wie diese geeignet, die Arbeit der UNESCO zu diskreditieren und Schulen wie unserer die Mitarbeit zu erschweren.
Meine Damen und Herren, als ich mir im Hinblick auf diese Gedenkveranstaltung überlegte, was mein Beitrag dazu sein
könnte, kam mir die für einen Lehrer naheliegende Idee: Ich frage unsere Schülerinnen und Schüler. Das sind wir als Lehrer ja so gewöhnt. Mich interessierte, ob die Schülerinnen und Schüler in ihren Familien noch die Möglichkeit haben, mit Zeitzeugen zu sprechen. Und mich interessierte insbesonders, welche Bedeutung sie einer Gedenkveranstaltung wie dieser beimessen. Ich habe daher an die Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 9 bis 12 geschrieben, ihnen mitgeteilt, dass ich die Ehre habe, bei der Veranstaltung zum Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und der Pogrome im November 1938 zu sprechen, und dass ich sie um
Mithilfe durch die Beantwortung folgender Fragen bitte:
• Gibt es in Eurer Familie noch Personen, die sich an diese Zeit erinnern können?
• Welche Bedeutung hat für Euch die Erinnerung an solche Ereignisse?
Ich habe die Fragen bewusst nicht durch die Geschichtslehrerinnen und –lehrer verteilen lassen, um nicht den Eindruck zu erwecken, es ginge mir um irgendeinen Kontext zum Fachunterricht oder gar um eine quantifizierbare Leistungserbringung. Ich habe sie über die Religionslehrerinnen und –lehrer gestellt, auch, weil der Lehrplan es hier am ehesten zulässt, einmal einem nicht vorgegebenen Thema Zeit zu widmen. Und ich habe offen gelassen, wie die Antwort gegeben werden kann – einzeln oder als Gruppe, mit Namen oder ohne, Abgabe beim Lehrer oder im Sekretariat oder ganz anonym im Briefkasten der Schule …
Wie die Lehrerinnen und Lehrer im Einzelnen mit meinem Anliegen umgegangen sind, weiß ich nicht (und wollte es auch nicht wissen). Einige werden meine Fragen mehr oder weniger kommentierend verteilt haben, einige werden eine Diskussion in der Lerngruppe angestoßen haben, einige haben offensichtlich Unterrichtszeit zur Beantwortung zur Verfügung gestellt. Ich habe von den etwa 500 Schülerinnen und Schülern 72 Antworten erhalten, darunter auch
solche, die von mehreren Schülerinnen und Schülern gemeinsam verfasst wurden. Sind das wenige oder viele Antworten? Ich kann nicht überschauen, wieviel Gespräche ich mit meiner Anfrage bewirkt habe, Gespräche in der Schule und Gespräche zu Hause. Und nicht jedes Gespräch, nicht jedes Nachdenken führt dann ja auch zu einer schriftlichen Antwort.
Nur in 11 Antworten konnte die erste Frage bejaht werden. Die Schülerinnen und Schüler berichten davon, dass jedoch nicht jeder Großeltern- oder Urgroßelternteil bereit oder in der Lage ist, darüber zu sprechen. Sofern es geschieht, sind es Kriegserlebnisse wie Bombenangriffe oder die Flucht oder die Vertreibung der Familie. Die Ausgrenzung und Verfolgung von Juden wurde nicht thematisiert, doch vermutet eine Schülerin, dass das Engagement ihrer Großmutter für Flüchtlinge ein Reflex darauf sei, dass sie die Ausgrenzung von Juden miterlebt habe.
Bei der Frage nach der Bedeutung der Erinnerung an Ereignisse wie die Pogrome im November 1938 bringen fast alle Antworten zum Ausdruck, dass die Erinnerung wichtig sei als Warnung, damit solche Ereignisse nicht wieder geschehen können. Eine Schülerin oder ein Schüler schreibt ausdrücklich von der Notwendigkeit eines „immerwährenden Gedenkens“. Nur vier Beiträge nehmen eine andere Position ein, möchten mit der Erinnerung an diese Ereignisse abschließen, um – wie zwei Schülerinnen oder Schüler sinngemäß schreiben – davon unbelastet in die Zukunft blicken zu können.
Bei der Erinnerung an die Pogrome empfinden die Schülerinnen und Schüler Unverständnis und Trauer, aber auch Entsetzen. Eine schreibt:
„Wie kann man einen solchen Hass auf andere Menschen haben? Wie kann man damit leben, so etwas getan zu haben? Wie konnten die überlebenden Betroffenen damit zurechtkommen? Wie konnten Juden danach je wieder ohne Angst leben?“ In einem anderen Beitrag steht, dass die Erinnerung „zeigt, wozu der Mensch fähig ist, obwohl
man denkt, dass man selber nie zu so etwas fähig wäre.“ Und mehrmals wird der Gedanke geäußert, dass wir „es den Opfern schuldig [sind], dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen“.
In vielen Beiträgen wird die Erinnerung an die Pogrome mit der Wertschätzung für die Gegenwart, in der die Schülerinnen und Schüler leben, verbunden. Man merke dann erst „was für ein Glück man hat, in der heutigen Gesellschaft leben zu dürfen“, schreibt ein Schüler. Oder: „Das Zurückschauen an diese Zeiten bringt mich dazu, mein Leben und Möglichkeiten immer mehr zu wertschätzen.“ Oder: „Wir sind alle so undankbar geworden und vielleicht helfen die Erinnerungen an solche Ereignisse unserer Generation, dankbar für das zu sein, was wir haben. Ein Dach überm Kopf, das nicht jeden Moment zerbombt wird, Essen und Trinken im Überfluss und eine (hoffentlich) noch heile Familie …“
Dass dies auch in der Sicht der Schülerinnen und Schüler nicht selbstverständlich ist, dass Frieden und Freiheit auch bewahrt werden müssen, sieht man daran, dass sich etliche Beiträge mit der Frage befassen, ob solche Ereignisse wieder geschehen können. Eine oder einer schreibt: „Ich habe immer gedacht, dass so etwas nicht mehr passieren kann. Seit einiger Zeit bin ich mir da nicht mehr so sicher.“ Die Schülerinnen und Schüler verweisen auf die Bewahrung der Menschenrechte, auf die Abwehr von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Einer formuliert ausdrücklich, dass es „die Pflicht unserer Gesellschaft ist, dies zu unterbinden.“ Andere formulieren ihre Bereitschaft zu einem Einsatz für eine „friedlichere Welt, in der Liebe und Toleranz statt Hass und Verfolgung“ bestimmend sind. Ein Beitrag kann als Zusammenfassung dieser Gedanken betrachtet werden: „Wir sind nicht verantwortlich für das, was damals passiert ist, sondern dafür, dass es nicht erneut passieren kann.“
Ich bin dankbar für diese Rückmeldungen, die einen Einblick in die Gedanken dieser Schülerinnen und Schüler ermöglichen. Ich hoffe und wünsche, dass sie sich ihre Idee einer friedlichen und gerechten Welt bewahren und dass sie sich in ihrem weiteren Leben nach ihren Möglichkeiten dafür einsetzen.
Und gerne bedanke ich mich bei denen, die ihren Beitrag mit ihrem Namen versehen haben, in den nächsten Tagen mit Schokolade. Und bei denen, die dann aus ihrer Anonymität heraus treten, natürlich auch.
Ich möchte schließen mit Gedanken des Theologen Johann Baptist Metz, dem Begründer der „Neuen Politischen Theologie“, der wichtige Impulse für den christlich-jüdischen Dialog gegeben hat und dafür 2002 die Buber-Rosenzweig-Medaille erhielt. Er sagte in einer Adventspredigt:
„Es gibt ja solche und solche Erinnerungen. Es gibt Erinnerungen, in denen wir es uns leicht machen im Verhältnis zur Vergangenheit; Erinnerungen, in denen uns die Vergangenheit zum unangefochtenen Paradies wird … Die Vergangenheit wird gefiltert durch ein Klischee der Harmlosigkeit; alles Gefährliche und Bedrängende, alles Herausfordernde an ihr ist verschwunden …
Es gibt aber auch eine andere Form von Erinnerungen: Es gibt gefährliche Erinnerungen, Erinnerungen an einst widerfahrene und inzwischen verstummte oder verdrängte Hoffnungen und Schrecken, die plötzlich inmitten unserer einschichtigen Alltagswelt wieder durchschlagen. Sie beleuchten für Augenblicke grell und hart die Fraglichkeit dessen, womit wir uns scheinbar abgefunden haben, und die Banalität unseres vermeintlichen ‚Realismus‘. Es gibt Erinnerungen, mit denen wir zu rechnen haben, Erinnerungen sozusagen mit Zukunftsgehalt, Erinnerungen, die uns nicht trügerisch entlasten; im Gegenteil … Solche Erinnerungen sind wie gefährliche und unkalkulierbare Heimsuchungen aus der Vergangenheit. Sie sind nicht dazu angetan, unsere herrschenden Ansichten zu bestätigen oder auszuschmücken, sondern sie aufzustöbern und zu hinterfragen. Solche Erinnerungen drängen uns dazu, uns unter ihnen zu wandeln, wenn wir ihnen standhalten wollen.“
Deshalb brauchen wir Gedenkveranstaltungen wie diese, und wenn meine Fragen an die Schülerinnen und Schüler dazu beigetragen haben, ihr Augenmerk darauf zu lenken, dann wurde viel erreicht.